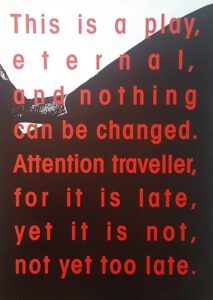 *
*
In Indien wird der lebendige Seinsvorgang auch ein Spiel genannt, ein immerhin großes und göttliches Spiel (Maha Lila), auf einem grundsätzlich illusionären Teppich herrlich ausgebreitet, und immer ein göttliches Wort zur Verfügung, um einem, wenn man so möchte, die Spielregeln zu erklären, an die man sich halten kann oder auch nicht. Da im Buddhismus und im Hinduismus auch der Tod nur ein Tor zu weiterem Erleben ist, wird er ähnlich zelebriert wie andere Festlichkeiten. Man hat Rituale erfunden, um Ausschau zu halten nach Zeichen, was die verschwundene Form als nächste Manifestation zu bieten hat. Die menschliche Gestalt zu erlangen gilt bereits als Höchstleistung, wer weiß schon, was man womöglich vorher war, Wurm oder Eidechse oder Adler usw., und dann: nur Menschenform geworden, noch nicht menschenmögliche, geistig geschulte Ausführung, noch nicht Menschsein. Alles kann immer mal wieder aufhören oder wieder anfangen, oder einfach weitergehen, wenn man den Weg des Flusses oder die Eigenart der Delphine oder die Himmelsshpären so weit durchgrübelt hat, dass man, ganz unversehens, auf das verbindende Gesetz stößt, nicht menschengemacht, aber menschenbegrenzt. Im Westen bin ich öfters mal bei dem Wort „Spiel“ auf Widerstand gestoßen, verständlicherweise. Es hat ja (nicht mehr) diese federleichte, helle Begleitung, wie nur Götter sie gewähren können, sondern zeigt sich als bleischweres Bündel der menschlichen Bürde, die einem auferlegt wird als Schicksalsklumpen, bei dessen Formierung man keinerlei kreativen Anteil hatte. Der dann zu therapeutischen Expert:innen gebracht wird, um etwas Licht ins Dunkel zu bringen. Aber diese Tragweite ein Spiel zu nennen? Ein Abenteuer also, in dem man der persönlichen Entwicklung wegen zu allerlei Prüfungen bereit ist, die zu bestehen sind, obwohl keiner, auch kein Gott und kein Vater und keine Mutter und kein Coach und kein Lehrer hier mehr was zu sagen oder zu behaupten oder zu kontrollieren hat, denn irgendwann ist es soweit: nicht als Kind kehrt man zurück zum Urgrund, sondern automatisch spült einen die Bewältigung der Szenen hinein in den eigenen Ton, und der kreative Geist macht sich an die Gesänge, wie auch immer, mit was auch immer, wo auch immer, aber nicht mit wem auch immer. Denn in der Tat braucht man Mitspieler:innen, jede/r für jede/n die Mitspieler:innen, damit das Spiel geschliffen, arglos und mächtig, nicht machthungrig ist. Am mächtigsten aber ist die Nähe des Todes. Alle derzeit Unbeteiligten weichen zurück, nur du bist mittendrin: du verlässt die derzeitige Heimat. Alles, was du warst und bist, nimmst du mit. Mit dieser radikalen Solo-Performance verlassen wir (irgendwann) einander. Wir wissen nicht, was er denkt, der Blaue Planet, und was wir mit uns auf ihm gemacht haben.
* von einem unserer früheren Performance Programmhefte

nahtlos
Vor einem Jahr, genau um diese Zeit, erlag ein Mensch, der mir sehr nahe war, einer tödlichen Krankheit. Zuerst schien die körperliche Befindlichkeit auf etwas hinzudeuten, etwas Vorübergehendes im Raum des Heilbaren, bis klar wurde, am zweiten Juni, dass das nicht so war, alles ging sehr schnell. Noch zwei schwer zu ertragende Wochen ging es weiter ohne den geringsten Strohhalm, dann hatte ich das Glück, beim letzten Atemzug anwesend zu sein. Das Unfassbare ließ sich nicht fassen. Hat es bis heute, ein Jahr später, eine Fassung erhalten? Ich sehe sie nicht. Vielleicht kommt der Tag, wenn man das Gefühl hat, abschließen zu müssen, aber was abschließen? Die Geschichte, oder die Erinnerung, oder die Trauer, oder den Verlust? Oder gar nichts abschließen, gibt es doch Orte, die nur für uns selbst bestimmt sind, unsere Quelle eben, an der das Geheimnis die undurchdringliche Sphäre bildet, in der nur der eigene Geist seine Geburt und Belebung erfährt, oder das natürliche Streben nach Vollkommenheit, von dem Hippokrates sagt, dass es zu Ergebnissen führt, die das Leben schmücken. Das Inspiriertsein davon also, vom unerschöpflichen Reichtum des Anwesenden, dem immer nur ein gewisser Zeitraum zur Verfügung steht, bevor es erlischt, und wer weiß schon, wie es dann weitergeht. Und selbst, wenn es weitergeht oder ginge, so ist doch erst einmal das gerade durchquerte Drama abgerundet, wenn der letzte Atem den Körper verlasst. Es wird ja behauptet, dass der Körper dann leichter wird, und niemand weiß, was mit dem fehlenden Gewicht geschieht. Da, wo Reinkarnation unangefochtenes Gesetz ist, kommt kein Zweifel auf, darf auch nicht aufkommen, sonst stünde vieles, wenn nicht alles, in Frage, eine Frage eben, die keine/r beantworten kann. Auch der Dalai Lama soll als kleines Kind zum richtigen religiösen Objekt gegriffen haben, um dann der Auserwählte zu werden. In Welten, die zu lange das Heilige oder das Geheiligte verkündet haben, taucht irgendwann der ausgleichende Abgrund auf, als Schrecken, als Tod, als das gänzlich Unerwartete, das als normal Deklarierte, das dann, wenn seine Zeit vorbei ist, entweder erlischt, oder zwanghaft aufrecht erhalten werden muss. Der Form oder der Followers oder der Familie wegen. Weswegen der Zeitraum vom lebendigen Jetzt bis an das immerhin denkbare Ende immer anspruchsvoller wird, wenn man denn Anspruch an und Zumutung für sich selbst liebt. Denn wie wäre die Zeit, die sich ergebende, besser zu erleben, als zu sein, wer man ist. Wer man ist.
(m) I – T (ea)
Mai Tea
mighty
Was hat Liebe mit Einsamkeit zu tun?
Alles. Die Akzeptanz der eigenen Einsamkeit ist die Voraussetzung, um einen anderen wirklich zu lieben. Wenn wir diese Einsamkeit jemandem zeigen, der sie wiederum sieht und akzeptiert, ohne uns davon abbringen zu wollen, und wenn der andere uns seine Einsamkeit zeigt – das birgt die Chance einer wirklich liebenden Beziehung. Einsamkeit ist ein Fakt. Wir sterben alle allein. Das wäre sonst wieder dieses romantische Ideal des Eins-Seins, das uns verkauft wird, als müssten wir nur den Richtigen finden, um nie wieder allein zu sein. Ich halte das für Fiktion. Und für eine Verschwendung einer existentialistischen Wahrheit. Es ist sehr gesund zu wissen, wie einsam wir sind. Die liebevollsten Beziehungen in meinem Leben – davon gibt es viele – habe ich zu Menschen, die sich ihrer Einsamkeit bewusst sind und keine Angst davor haben. So können wir uns wunderbar Gesellschaft leisten. Es ist ein guter Weg, um gute Freunde zu finden.

Leuchtkraft
Überall in der Welt sind trotz der maßlosen Vielfalt auch erstaunlicherweise sehr ähnliche Muster des menschlichen Verhaltens aufgetaucht, es wird geheiratet, irgendwie Geld aktiviert, zusammengefunden, auseinandergesetzt, gelernt, gelobt, gepriesen, ritualisiert, praktiziert undsoweiter. Dennoch wird das Fremdartige meist hervorgehoben, der Mensch braucht sichere Verhältnisse, die oft nur in engen Banden ermöglicht werden. Auch kann man vermutlich jegliche Art von Menschengruppe zusammenfügen und ohne gemeinsames Thema eine Weile miteinander leben lassen, da wird es bald mehr Klarheit darüber geben, wer wo was wann und wie macht. Es kann Kämpfe geben, wenn Machtinteressen aufeinanderprallen, jemand wird sich durchsetzen, im guten oder im schlechten Sinn, das hängt von denen ab, die sich auf irgendeine Weise gewählt haben. Die Qualität der Gesellschaft hängt notwendigerweise von den Einzelnen ab. Deshalb kann es so immens wichtig sein und werden, wenn menschliche Wesen erwachen und Verantwortung übernehmen für ihre eigenen Köpfe (und Körper). Das ist zwar in jeder Zeitepoche durchaus empfehlenswert, aber gewinnt an Dringlichkeit, wenn sich eine als „besonders“ empfundene Zeit aus den Angeln der Ewigkeit hebt und kollektiven Anspruch erhebt auf Erwachen. Das seit Jahrtausenden als geistige Höhe angestrebte Gut bietet sich (wegen der Dringlichkeit der Verhältnisse) an als eine Möglichkeit, eben: erkenne dich selbst, und dann gleich dahinter folgt: alles in Maßen. Selbst den Algorhythmus, wie ich ihn nenne, den großen, mächtigen Menschengeistfänger, kann man in Dienst stellen, wenn man weiß, was noch (in mir) zu suchen oder zu finden ist, oder wessen geistige Nahrungsquelle für mich tatsächlich eine Relevanz besitzt. Natürlich kann man, wenn man die grundsätzlich von einem gewünschte Weite und Tiefe der Informationsquellen geklärt hat, dort auch einiges an Reichtum hervorzaubern. Die gleichermaßen erstaunliche Vielfalt der düsteren Krankheiten, die den Planeten durchziehen, weist allerdings darauf hin, dass sehr viel Materialschaden entstanden ist, und natürlich ist man sehr dankbar dafür, dass, sollte man sie benötigen, natürliche mit künstlichen Teilen ersetzt werden können, die das Leben zerschlissen hat. Vielleicht ist daher die Sehnsucht so groß, durch technische Ersetzung unversehrter zu werden. Verblüffend ist immerhin, dass, wenn höchste erreichbare Tiefe mit höchster erreichbaren Höhe zusammentrifft, viel Energie entsteht, die es zu navigieren gilt. Alles hängt davon ab, wo diese Energie hinweist.
 *
*
Simples Puzzle
In Byung-Chul Han’s Büchlein „Transparenzgesellschaft“ hat mir eine kleine Geschichte so gut gefallen, dass ich sie hier wiedergeben möchte, damit sie nicht verloren geht: Ein Rabbi, ein wirklich kabbalistischer, sagte einmal: um das Reich des Friedens herzustellen, werden nicht alle Dinge zu zerstören sein und eine ganz neue Welt fängt an, sondern diese Tasse oder jener Strauch oder jener Stein und so alle Dinge sind nur ein wenig zu verrücken. Weil aber dieses Wenige so schwer zu tun und sein Maß so schwierig zu finden ist, können das, was die Welt angeht, nicht die Menschen, sondern dazu kommt der Messias.“ Allerdings ist es nicht das Versprechen des kommenden Messias, was mir gefällt, sondern es hat mich gereizt und angesprochen, dieser Schwierigkeit spielerisch entgegenzutreten, indem ich um mich geschaut habe in meinem Raum und von der Idee ergriffen wurde, alles darin Vorhandene ein klein wenig zu verrücken, sodass dadurch automatisch eine ganz neue Ordnung entsteht und ich damit rechnen kann, dass diese Veränderungen sich in irgendeiner spürbaren Weise auf mich auswirken werden. Es wäre nötig, es bewusst zu erfassen, denn wir wissen alle, dass wir uns ständig verändern, aber meist nehmen wir es nicht bewusst wahr, weil der Prozess des Lebens schleichend ist. Es wäre also interessant zu beobachten, ob die Wirkung solcher Veränderungen tatsächlich spürbar ist, ohne in esoterische Gaukeleien zu verfallen. Es ist doch verblüffend, wie lange sich dingliche Zusammensetzungen halten können, und selbst nach Entstaubungen sieht man dieselben Kompositionen sich formieren, so, als gäbe es keine andere Variante als die bereits von einem entschiedene. Es ist ja nicht so, als würde man nicht mal umräumen, aber dann scheint es doch nach vielen Experimenten eine nahezu optimale Formation zu geben, um die sich die kleinen Objekte dann alle herumscharen ins nahezu Unauflösbare. Nun, da hier im Haus neuerdings viel um verbleibende Zeiträume herumkontempliert wird, enthält die Anregung eine neue Dimension. Also, wie es eine kluge Frau neulich mal formulierte, weg vom Flip-Flop, und: ran an die Realität. Es ist (leider) leicht für gerade nicht Sterbende, sich Gedanken zu machen über die Möglichkeiten, die bestimmte verfügbare Zeiträume anbieten. Auch dazu gibt es scheinbar krasse Sätze aus den yogisch geprägten Welten, wie zum Beispiel „Stirb, bevor du stirbst“. Aber auch wenn einem das Einleuchten des Satzes gelingt, besteht weiterhin die Frage: wie geht’s. Und ist es s o gemeint, dass man mit diesem (Ich)-Tod dann eine direktere Wahrnehmung des Lebendigen hat, und dass das auf jeden Fall ein Schritt in die „richtige“ Richtung wäre, egal, wie lange man das erleben könnte. Oder sich dem Ganzen einfach von Herzen und in vollem Vertrauen überlassen, da ich erkannt habe, dass das Ganze eh nach einem innewohnenden Programm abläuft, dem ich mich durchaus anvertrauen kann. (!?)
* Wann wird das, was man an Vorhandenem zusammenfügt, zu Eigenem?

Trugbild des Tempels
Auch das Meer kann so vieles sein, natürlich sich selbst, aber vor allem Symbolik für das, was man grad benötigt: Sehnsucht, antike Tempel, Weite, Glitzern der Oberfläche, Beweis des Unergründlichen, Ruhestätte der Körper, um nur ein paar zu nennen. La mer, phonetisch auch Mutter, oder Mutterschlund, dem die Söhne zu trotzen bestrebt sind als Antrieb für ihre Heldentaten. Das Rauschen der Wellen kann einen in Schlaf wiegen wie ein Kind, aber auch aufwühlen mit dem ewigen Singsang. In seinem Gedicht „Was schlimm ist“ hat Benn folgende Zeile:…“Nachts auf Reisen Wellen schlagen hören und sich sagen, dass sie das immer tun“. (Gottfried Benn, Meister des Furchterregenden). Das NochmalschnellzumMeerfahren vor der Abreise dient natürlich dem Wunsch, das Meer noch einmal zu sehen als Abrundung des Wochenendes. Vor nichts lässt sich leichter verneigen als vor dem Meer, ein Dank bewegt sich im Innern an die Großzügigkeit des Schicksals, denn immerhin: keine Kriegsschiffe unterwegs, nur Schemen vom Nichtwissbaren. Auch lockt zuweilen das Genug, man muss nicht immer alles bis zur Neige ausschlürfen wollen (und so manches wird gar nicht weniger, obwohl man davon trinkt oder trunken werden kann). Und ja, immer gut, mal vom Gewohnten entfernt zu sein, es kann das Eigene liebenswert erscheinen lassen, der Garten was verwilderter als dort die strahlenden Binsen, also beides ruhend in ihrer Schönheit, nur anders. Und wie zu erwarten war, fuhren wir im holländischen, dem Menschlichen gewogenen Tempolimit mit sehr vielen Anderen zurück, und nun ist schon wieder Mittwoch, wie konnte das geschehen. (Das war ein Scherzlein mit Windschatten).

Im Mittelteil der Erzählung muss klar werden, um was es geht, obwohl die Frage jederzeit als Orientierung angebracht ist. Wenn (wir) Menschen Ferien machen oder uns aufmachen zu einem Wochenende mit reservierten Zimmern, geht trotz der in Anspruch genommenen Freizeit nichts von selbst, nein, sondern man muss eine ganze Menge sortieren. Leicht kann man zur Wühlmaus in der eigenen Reisetasche werden, obwohl alles erst so proper zueinander gelegt schien. Was wir auch wussten, war, dass wir als Gast einen tiefdunklen Schatten dabei hatten, (noch) nicht aufdringlich, aber dennoch spürbar: es war die Wirkung des dumpfen Gongschlags einer Diagnose, die Eine von uns getroffen hatte. Unser Leben navigierte bereits durch die Wellen dieses Ozeans, als unsere Blicke auf die stürmische Flut des Wassers trafen. Irgendwann weiß man, dass es keine überschaubare Reihenfolge des Sterbens gibt, denn einfach alles Denkbare und Undenkbare kann jederzeit geschehen. Ist man nicht selbst der oder die Betroffene, können einem sehr viele, auch hilfreiche Dinge einfallen, aber zum Glück werden die Ratschläge karger. Und es stimmt, dass für die, die bleiben, der Tod ein unlösbares Problem ist. Es trifft immer nur Eine/n allein, das kann man als die Schönheit des Wahren bezeichnen. Wer behauptet denn, dass es leicht sei. Vor allem, wenn der betroffene Mensch noch alles selbst entscheiden kann: die Kraft des Meeres spüren, das Zittern der Blätter auf dem sandigen Waldpfad, der Empfang des Zustroms warmer Gefühle, die sich nun im Rahmen des Geschehens größerer Zulassung erfreuen. Denn noch ist der Mensch, die einem am Herzen liegt, da. Noch da noch. Noch da. So war diese Auszeit von sonnigem Wetter gekrönt, aber ein kalter Wind wehte um die, die sich ins Freie hinaus bewegten. Nur die Surfer, aber vor allem ein einziger Surfer, ließ sich von den Hindernissen nicht einschränken. Ja, das Hindernis war gerade der Ansporn! Er ließ sich von seinem Windfang hochtragen in die Lüfte, kam wieder herunter auf die Wasseroberfläche, und weiter ging die Fahrt. In diesen Stunden wird vieles zum unerwarteten Genuss. Der Geschmack einer Avocado, eine heiße Dusche, ein Menschengesicht, dass einen liebevoll anschaut. Wenn Tiefe und Flüchtigkeit keine Angst mehr hervorrufen.

Kurz bevor wir uns vergangenen Freitag ans Meer aufmachten, las ich einen Satz von Ibn Battuta über das Reisen, der sich mir eingeprägt hat: „Reisen – macht dich sprachlos und verwandelt dich dann in einen Geschichtenarzähler“ (oder eine Geschichtenerzählerin), was der nackten Wahrheit entspricht, denn vor allem, wenn man sich in unvertrauten Gefilden aufgehalten hat, kommt man mit allem möglichen zurück, und oft genug versteht man durch die eigene Mitteilung erst, was man tatsächlich erlebt hat. In Wirklichkeit waren es für uns gar keine unvertrauten Gefilde, denn viele Male waren wir schon, zusammen oder einzeln, dort gewesen, in Holland, und vor allem bei einem verlängerten Wochenende mussten wir damit rechnen, dass ein nicht geringer Teil der deutschen Bevölkerung sich dort am Tummeln war. Es stört nicht, alle sind mehr oder weniger mit denselben Dingen beschäftigt wie an allen Orten, an denen die Schönheit der Natur Unmengen von Menschen angezogen hat, deren ähnliche Bedürfnisse von Einheimischen immer professioneller bedient werden, sodass auf beiden Seiten ein gewisses Maß an Zufriedenheit anwächst über die Vorgänge. Und je mehr Geld hereinfließt, desto schöner werden die Wege, je klarer die Ordnungen und je teurer die Übernachtungsmöglichkeiten. Darin ähneln sich das indische Dorf und das holländische Dorf, indem ihre Besonderheit Anlass gibt für Reichtum auf beiden Seiten. Die Saison-Zeiten sind anders. In Indien beginnt die Saison im November und geht bis März, hier geht sie von März bis November. Man sieht so viel Gleiches, dass es dem Geist mühelos Distanzierung ermöglicht. Nein, nicht mühelos, oder ganz im Gegenteil muss man sich mächtig ins Zeug legen, um sich dem trägen Sog des Urlaubmachens zu entziehen, dem diese Atmosphäre untertan ist. Ist es zum Beispiel heiß und der kleine Ort hat einen Kleiderladen im Bazaar, so sieht man kurz darauf viele von diesen Kleidungsstücken herumlaufen, und obwohl es in der einzelnen Entscheidung etwas Individuelles oder gar Gewagtes darstellt, gibt es dem Gesamtbild seine ungeheure Ödnis. Nun hatten wir das Glück, uns in einem völlig umdesignten Hotel mit kraftvoller Preislage niederzulassen, und unsere Zimmer hatten nicht nur die Unversehrtheit des Nagelneuen, sondern waren, wie wir erfuhren, von der Frau des Hotelbesitzers persönlich gestylt worden, und man konnte sehen, dass hier eine Leidenschaft mit einem Talent zusammentraf. Man konnte sogar nachvollziehen, warum etwas weggelassen wurde (zum Beispiel eine Küchenzeile), das war undenkbar zusammen mit dem Design, alles in hellen Tönen. Im Frühstückssaal herrschte eine heilige oder besser heillose (?) Stille, so konzentriert war die Aufmerksamkeit auf den großen Teller, auf dem vom übermäßigen Angebot des Frühstücksbuffets d a s lag, was jede/r von uns glaubte, verkraften zu können. Es war viel, sehr viel, und nicht immer leicht oder nötig, sich an sein eigenes Maß zu erinnern. (Oder doch?). Im epikureischen Sinn ist an dem gelegentlichen Übermaß nichts zu bemängeln. Hauptsache, es bekommt einem und ist mit dem Geschenk des seltenen Genusses verbunden. Wie von Ibn Battuta gesagt, man kommt ins Erzählen, und nun bin ich nur bis zur Einleitung gekommen und werde morgen selbst noch sehen, wie es weitergeht.

Erst neulich habe ich erfahren, dass man auf dem Weg zum Orakel von Delphi, einer Weissagungsstätte, erst durch e i n Tor ging, auf dem der berühmte Satz „Erkenne dich selbst“ steht. Und dann war da ein zweites Tor, auf dem stand: „Alles in Maßen“. In der materiellen Welt gibt es Maßbänder, die man anlegen kann, da geht es um Altbewährtes, in das man Vertrauen legen kann, die Benutzung ist von kompetenten Weltlingen überprüft worden. In der inneren Welt ist es anders, obwohl es auch hier zwischen beiden Verbindungen gibt. Anders ist, dass jedes Ich in seiner oder ihrer Welt für die Erzeugung und Gestaltung eines Maßstabes verantwortlich ist, denn egal, wie groß der Einfluss von draußen auch sein mag, so bin ich doch in letzter Konsequenz immer in eigener Gesellschaft und muss bewusst oder unbewusst damit umgehen, was da drinnen in mir passiert, das ganze Zeug also, das mich (angeblich) ausmacht. Es kann überwältigend sein, wenn man realisiert, dass alles, was in meiner Welt passiert, Wirkung nach außen hat. Es wird aufgenommen vom Raum und geht seine eigenen Wege. Nun kann man, im Rahmen des Wunsches, eigene Ordnungen (z.B.) für persönliche Gärten und Labyrinthe und Oasen zu erschaffen, die auch im Geistigen zu erleben sind, ein Maß brauchen für beide Welten, das für einen selbst glaubwürdig und umsetzbar ist, auch wenn die Erfahrung des Scheiterns immer eine der Möglichkeiten darstellt. Was gehört alles zum eigenen Leben, wo hat es das vorgestellte Maß nicht erreicht, und wo ist es maßlos geworden, sodass einem zuweilen etwas einfallen muss, um noch rechtzeitig die Kurve zu kriegen. Wie das umgedrehte Kalenderblatt muss auch der der selbst konstruierte Maßstab immer mal wieder erfrischt werden. Oder man holt sich einen Teil von Delphi in den Garten, baut zwei schöne, grazile Tore hintereinander, die die beiden Sätze so sichtbar machen, dass man sie kaum wieder vergessen kann. Natürlich nur, wenn man sie sehen will, obwohl man die Tore innerlich vielleicht noch klarer gestalten könnte. Man müsste ihnen eine eigene Ebene bauen, wo erst einmal gar nichts ist, ich meine: gar nichts. Man schaut sich schon aus Gewohnheit um, was für ein Material zur Verfügung steht, aber da ist nichts, und es kommt auch nichts. Aber es ist ja bereits etwas da, das wird jetzt erst deutlich. Die Sätze sind da, für die sollten ja die Säulen sein. Aber warum Säulen bauen, wenn die Sätze sich bereits durchgesetzt haben. Und der ganze Aufwand ist eh nur für einen einzigen Nu, nämlich den, wo ich mich erneut fragen kann, ob ich mich auf dem Weg des Selbsterkennens bewege, oder ob ich am Steuer des Schiffes erschreckt aus dem Schlaf hochfahre und in vorletztem Nu einem Eisberg ausweichen muss, oder smoothly vorangleite mit Zeit für gute Performance. Eben dann, in beiden Situationen, der Aufruf des zweiten Satzes: alles in Maßen.

Beschriftetes Dunkel
Vor allem in ihrer einfachsten Zusammenfügung können bestimmte Sätze, in denen sich ein Tropfen Wahrheit gebildet hat, die eigenen Gedanken und Vermutungen in Unruhe versetzen, weil man immer mal wieder glaubt, ihre Bedeutung erfasst zu haben, und immer wieder muss man sich neu an die Arbeit machen. Was heißt das, zum Beispiel, dass alles ist, wie es ist. Es kommt einem logisch vor. Aber wie i s t es denn? Ich schaue also und schaue, und lasse den Blick über das Vorhandene gleiten. Sobald ich in meinem Schauen irgend etwas mit meiner persönlichen Meinung bedenke, ist es nicht mehr, was es ist. Vielleicht ist es vor allem die Gewohnheit, mit der wir unsere selbst eingerichteten Welten bewohnen, die uns etwas Luft lässt und vor allem die Dinge sein lässt, was sie sind. Viel schwerer ist es mit Menschen. Man kann deuten, so viel man will, aber erfahren, wer sie sind, oder erfahren, wer man selbst ist, kann man nur, wenn man aus dem inneren Dunkel heraustritt ans Licht, also das ganz einfache Licht des Tages, in dem wir uns miteinander bewegen. Aber was heißt dann: es ist, wie es ist. Denn einerseits ist unser Auftritt einmalig, denn das, was jetzt ist, wird nie wieder erscheinen. Doch andrerseits kann gerade diese Persönlichkeit, die wir in uns kultivieren, auf einmal im Weg stehen, so, als wäre es geradezu die Aufgabe der Selbsterkenntnis, einen Weg zu finden, der einem ermöglicht, sich selbst nicht im Weg zu stehen. Eine Formel, die Staubkorn und Atem verbindet. Vielleicht nicht einmal ein Staubkorn an der Wimper des schöpferischen Auges, nein, gar nichts, rein gar nichts. Und vermutlich tanzt dann erst der Fuß in der Schönheit der Leere. Alles ist ja noch da, nur man selbst: verwandelt.
Ode an einen Stern
Neulich in der Nacht
beugte ich mich auf der Terrasse
eines riesig großen, stolzen Wolkenkratzers
weit hinaus und berührte
das nachtschwarze Himmelsgewölbe.
In einem Anfall hemmungsloser Liebe
griff ich nach einem himmlischen Stern.
Schwarz war die Nacht
und ich schlich durch die Straße,
in meiner Hosentasche der Stern,
den ich geklaut.
Er war zerbrechlich und zitterte wie Kristall.
Dann kam es mir vor,
als trüge ich einen Packen Eis
oder das Schwert eines Erzengels am Gürtel.
Behutsam versteckte ich ihn unter meinem Bett,
damit niemand ihn entdeckte.
Aber sein Licht
drang zuerst
durch die Wolle der Matratze,
dann
durch die Dachziegel meines Hauses.
Ach, wie schwer
wurden mir
meine ganz privaten Angelegenheiten.
Ständig umgab mich
sein astrales Leuchten,
das so unruhig flackerte,
als möchte es zurückkehren
in die Nacht.
Nicht länger konnte ich mich
um meine Pflichten kümmern.
Ich vergaß, meine Rechnungen zu bezahlen,
und hatte kein Brot und gar nichts mehr.
Währenddessen liefen auf der Straße
die Leute zusammen –
Spaziergänger, fliegende Händler,
sie alle schlug der nie gesehene Glanz,
den sie aus meinem Fenster kommen sah’n,
in seinen Bann.
Da nahm ich noch einmal meinen Stern,
wickelte ihn vorsichtig in mein Taschentuch,
verhüllte mein Gesicht,
schritt durch die Menge
und wurde nicht erkannt.
Ich wandte mich gen Westen,
lief zum Grünen Fluss,
der unter Weiden ruhig fließt.
Ich nahm den Stern der kalten Nacht,
warf ihn ganz vorsichtig
ins Wasser.
Wie staunte ich, als er sich davonmachte.
Ganz wie ein richtiger Fisch
bewegte er seinen Leib.
Ein Diamant war er
in der Nacht des Flusses,
der ihn davontrug.

Es ist doch erstaunlich dass, senkt man den Blick ins Lebendige, alles zum Leben erwacht und selbst die ödesten Dinge ihre Schönheit entfalten können (oder ist das schon Liebe?) Lässt man aber den Blick in die Welt des Todes und des Sterbens gleiten, so kann man gleichermaßen erschaudern ob ihres steten Stromes und ihrer selbstverständlichen Gegenwart. Und vollkommen unabhängig agiert dieser eher kühle Windhauch von der gängigen Idee, Sterben sei vor allem mit Alter verbunden, wobei es zu beglückwünschen ist, wer es erreicht. Nein, überall stirbt und lebt es in immer neuen Kombinationen. Ich denke an einen indischen Begriff der Erde, mit dem sie als Planet der Toten bezeichnet wird, da sich beide, die Toten und die Lebendigen, dort vermischen und schwer zu erkennen sind. Und man kann sich auch mal tot fühlen oder totärgern, ohne dabei gleich die Welt zu verlassen. Totkrank ist dann noch einmal eine ganz andere Ebene. Man muss entscheiden, ob ein Kampf angesagt ist oder überhaupt sinnvoll erscheint (oder die Idee der Sinnlosigkeit aushebeln), oder aber sich dem Strom des Geschehens hingeben, wohl wissend, dass ein Gong geschlagen hat, der wiederum alles Mögliche bedeuten kann, nicht muss. Automatisch entfaltet sich Gewesenes vor dem Auge, kann gestreift werden oder analysiert: nur ein einziger Mensch hat jeweils diese e i n e Geschichte. Alles, was darin geschieht, geschieht auf diese Weise nur einer einzigen Person. Daher, wenn es zur freiwilligen oder durch Umstände als angebracht empfundenen Zusammenfassung einer Lebenszeit kommt…was dann? Die Überlebenden kann man hier ausschließen, denn sie sind, bzw. wir sind meistens froh, wenn wir (noch) leben. Als ich meine Mutter beim Sterben begleitet habe, voller Erstaunen, dass es überhaupt dazu kam, bin ich manchmal wegen einer Besorgung kurz hinaus in die Stadt, aber das geschäftige Leben sprach mich nicht an, ich wollte zurück, dort passierten noch wichtige Dinge. Manchmal sank sie (meine Mutter) in einen Dämmerzustand, aus dem heraus sie einmal berichtete, mein Vater würde sie rufen, mit ihm auf dem Grasboden zu tanzen, aber ihre Füße steckten fest. Oder ich entdeckte hinter ihrem Bett bei den Büchern das „Bardo Thödröl“, das Tibetanische Totenbuch, und woher hast du das, fragte ich. Sie hat mir erzählt, dass ich es einmal mitgebracht hatte aus Nepal, wo ich es, mich erinnernd, kaufte, als ein junger Freund von uns damals überraschend seinem Leben ein Ende setzte. Vielleicht hat auch das vielen geholfen, wenn auf keinem der Wege mehr Licht lag. Oder man kann es sich selbst wünschen, dass alles noch Verfügbare und Machbare dazu führt, dass sich die Flügeltüren öffnen, obwohl auch das schon zu viel Spekulation ist.
 *
*
Kräfte messen
Also (doch nochmal) zurück zu gestern und dem unseligen CNN Abend in einer Towns Hall (New Hampshire), für den sich Anderson Cooper heute früh entschuldigt hat, dann aber auch die Gelegenheit ergriff, um die eigentliche Ausrichtung zu erklären, die allerdings als gescheitert betrachtet wird. Die Wahl einer Person, die die Kraft aufbringen können würde, Donald Trump paroli zu bieten, fiel auf Kaitlan Collins (CNN), der man es wohl zutraute, oder sie traute es sich selbst zu, was sich als fatal erwies, und intelligente Gehirnstrukturen in Aufregung versetzte. Wie konnte es passieren, dass wiederum einem einzigen Mann, der bereits für seine Verbrechen vor Gericht stand und weiterhin stehen wird, hier Spielraum gewährt wurde, eine (alte) Lüge nach der anderen zu reproduzieren und dann auch noch von dem eingeladenen Publikum beklatscht und gefeiert wird. Dem Triumph der Dummheit eine Bühne geben, was sich übersetzt als freie Zugabe an die Hälfte des gespaltenen Landes, die sich und dem Vorspieler begeistert zuprosten, wären doch viele gerne auch so selbstbewusst und so gemein und so unwiderstehlich gleich wie dieser Dummkopf. Dann hatte er noch die Frau ganz nebenher beleidigt, die kam nicht mehr ran an ihre Durchsetzungskraft. Das Ganze war sehr peinlich, oder wie sagt man: der Schuss ging nach hinten los. Gerne würde man nun einen Super Hero herbeipfeifen, einen, der Dinge kann, die kein anderer kann, und uns zeigen, wie man die dreiste und niederste Form der Dummheit besiegt. Aber auch der Silver Surfer hängt grübelnd im All herum auf seinem Surfboard und versucht sein Bestes, um zu verstehen, warum menschliche Wesen sind, wie sie sind, also bereit, ihren eigenen Lebensraum zu zerstören und ihrem Nichtwissen gnadenlos Raum verschaffen. Nun gibt es weit und breit keinerlei solche Helden, warum auch…oder doch!? Da gibt’s zum Beispiel noch Jack Smith, den kalt einherblickenden Sonderermittler, den man extra geholt hat, um den kriminellen Ex-Präsidenten letztendlich doch noch zu Fall zu bringen, sodass man sich auch in Hinblick auf die anderen Kriminellen vorstellen kann, wie so was gehen könnte, aber wird er es können? Ich allerdings, an meinem Schreibtisch sitzend, muss mich auch fragen, was ich kann, und vor allem, was ich nicht kann, damit ich mir kein Maß nehme von all diesem Weltauseinandersetzungsgedrösle, wo vielleicht die Potentaten immer finsterer werden, bis sie ganz und gar von künstlicher Intelligenz gesteuert werden, und wirklich gar niemand ihre Herrschaft über uns mehr aufhalten kann. Bis dahin teile ich gerne mit Mitmenschen die Freude, dass noch etwas Luft zum Atmen da ist, und nicht nur nach oben hin, sondern nach allen Seiten hin große, leere Palmblätter.
*Henrike Robert
 *
*
Abgesehen von der kleinen Zwergenfreude darüber, dass die weltliche Gesetzgebung doch ab und zu gut zu funktionieren scheint, was z.B. den Urtypus des mythosumwobenen Narzissten Trump angeht, so sehe ich andrerseits in der Aburteilung von Habeck wegen Klüngelei des Staatssekretärs, also dahinter, weit dahinter, noch andere vorgeschobene Gründe, die strammstehen, um ihn abzusäbeln. Man muss zugeben, dass man Trump gerne fallen sehen würde. Vielleicht ist auch d a s eingebaut im Menschenwesen: die Lust des Zuschauens, vor allem, wenn andere fallen, die man wegen ihres Verhaltens gerne mit Verachtung straft, bis sie zur rechtmäßigen Strecke gebracht werden, im Leben, im Film, an den Tatorten der Welt also, wo die einem oft unfassbaren Geschichten der Menschen sich regelmäßig abspielen. Dann wiederum gibt es nur einen einzigen Trump. Für diesen Mann ist es normal, einer Frau zwischen die Beine zu fassen, hat er doch offensichtlich viel Erfolg mit der Überzeugung gehabt, dass jeder Frau so ein widerlicher Übergriff Spaß macht, wobei es zu dieser irrigen Einstellung nur kommen kann, weil Frauen oft in die Sprachlosigkeit fallen, in die Scham, in die Ohnmacht, wenn ihnen das Unvorstellbare zustößt. Und wieder einmal glaubt die halbe Bevölkerung eines Landes an die Unschuld ihres Sektenführers, ihres Halbgottes, ihres Erretters aus armseligen Leben. Und ja, obwohl er Milliardär ist, geben sie ihm gerne finanzielle Unterstützung, weil dieser Unhold genau ihren Vorstellungen eines Erlösers entspricht, einfach, dumm und gerissen. Das kann schon beunruhigen, weil überall dieselben Phänomene zu beobachten sind. Und wie gerne und stramm haben doch die Hitler-Followers den rechten Arm hochgestreckt, vereint in der Illusion des Zusammenseins, mit neuen Begriffen beschenkt, sich sofort erkennend am Gruß oder am Seitenscheitel, oder an der Mütze. Man muss wissen, dass es so ist, und sich nicht beirren lassen mit den eigenen Beurteilungen, oder auch bereit sein, diese ganz und gar zu lassen. In diesem Sinne höre ich jetzt einfach auf, denn weder kann ich Habeck freisprechen von seinem dumm gelaufenen Fehler, noch mich selbst von dumm gelaufenen Fehlern. Also kein Tag fürs Grübeln, auch kein rasender Aufschrei hörbar, aber dennoch: stetiger Anstieg des Beitrittsstromes, hinein in die AfD. Was heißt das.
* Bild: Henrike Robert

anblicken
Man vergisst so leicht, dass nicht nur wir ständig auf alles blicken, was sich vor uns abspielt, sondern die Welt, in der wir uns bewegen, schaut auch zurück. Aber meistens lassen wir es nicht sein, was es ist, sondern es wird kommentiert und bewertet und eingeordnet ins eigene Wahrnehmungsfeld. Auch dienen solche schlicht klingenden Erkenntnisse nicht dazu, sie irgendwann einmal für verstanden zu erklären, sondern es ist förderlicher, sich im Staunen zu bewegen und notfalls d a s, was man sich als „das Normale“ angeeignet hat, ab und zu aufzuscheuchen und auf seine angebliche Norm zu überprüfen. Ich erinnere mich an eine Geschichte, in der ein Mann sich selbst erzählt, was er so alles in der Wohnung hat, und woher er es hat, und wie schön es doch alles sei, so vertraut, so angenehm, so ganz er selbst, bis man als Leser:in langsam und unaufhaltsam begreift, dass der Gashahn schon die ganze Zeit den tödlichen Stoff ausströmt, obwohl der das alles Kontemplierende nun die Dinge in einem anderen Licht sieht, das jedoch nur durch diese gewählte (Er)Lösung auftauchen konnte. Die Objekompositionen in meinen Räumen sprechen auch deutlich eine eigene Sprache, denn die meisten Teile habe ich nicht selbst erschaffen. Ich sorge für die Zusammensetzung, und oft genug gibt es dann Landschaften, deren Ordnungen bereits im Reich der Spinnenwebe angekommen sind. Wie lange sitzt denn da schon der kleine Buddha, um den Hals meinen Schildkrötenring, vor dem kunstvoll geformten Frauenkörper aus Lehm (wie hieß sie doch gleich, und wie froh war ich, das von ihr (der Künstlerin), erstehen zu können, sprich: zu kaufen. Und an diesem Torsorand oben hängen schon sehr lange zwei Opiumknospen, ausgetrocknet wie die schwarzdunkelrote Rose, die da ebenfalls hingehört. Aber warum scheint es so unauflösbar wie eine indische Couch aus Bollywood, von der man weiß, dass sie nach ihrer Ankunft durch erschöpfte Sklaven nie wieder bewegt werden wird. Dabei gibt es in unserem Haus gar keine unverrückbare Couch, geschweige denn Kaminsimse, auf denen all die Lieben in Bilderrahmen versammelt sind, an die man sich erinnern möchte, warum auch nicht. Wenn man diese zähe Kraft der Materie öfters mal umsortieren würde, also neue Zusammenhänge erschaffen (was man ja auch zuweilen tut), wäre man immerhin noch mit einem gewissen Grad an geistiger Freiheit bei der Sache, während z.B. die meisten Flüchtenden gerade diese Freiheit unfreiwillig zurücklassen mussten: die eigenen Ecken, die Landschaften, die vertrauten Einrichtungen. Übernimmt aber die Katastrophe die Trennung von dem Blick und Anblck vertrauter Ordnungen, dann wird dem Geist viel zugemutet, und vieles, was war, scheint nun auf einmal so kostbar (gewesen zu sein).

Autopo(i)etisch
Das ist natürlich die Frage, ob man ein Zufallsprodukt auf der Rückseite eines Tabletts mit „auto“, also „selbst“, bezeichnen kann. Ich war ja (neulich) auf der Suche nach schwarzen Hintergründen, da habe ich den poetischen Fleck entdeckt. Es ist also eher so, dass es mein Auge brauchte, um zu entdecken, was ich unter „poetisch“ verstehe, zum Beispiel diesen aus dem absoluten Nichts erscheinenden Wuschelkopf, dessen Augen aus zwei Vierern bestehen, der Mund aus dem Wort „Made“. Es sagt uns also nicht, wo dieser Wortfetzen mal hindeutete, in ein Land, wo irgendwas gemacht wurde, sondern es sagt nur: gemacht. Vollendet, abgerundet. Dann als Augen zwei Vierer, die manifestationsbereit in die Zukunft schauen, wo, wer weiß, sich noch alles erschaffen kann oder selbst sich bildet, damit man nicht irgendwann aus Mangel an Überraschungen ermüdet. Man muss doch einfach mal zugeben, dass der ganze lebendige Erlebnisprozess nicht nur aus auf einen zurauschenden Überraschungen besteht, sondern man kann die Überraschungen auch gerne selbst erzeugen, wohl wissend und genießend, dass es höchstpersönliche Eingebungen sind, die hier zu den unterschiedlichsten Befindlichkeiten führen können. Ich darf ein weiteres Beispiel aus nächster zeitlicher Nähe geben: Es regnet ziemlich viel, und die von allen Gärtner:innen abgelehnten Schneckenhorden kriechen aus für uns unvorstellbaren Schleichwegen herbei, und im Scherz fing ich an, ihnen Namen zu geben: ah, da ist Leopold, und dort ist Elfriede usw., und tatsächlich merke ich, dass es einen Unterschied in meiner Wahrnehmung von ihnen macht. Die Fremdheit zwischen mir und ihnen ist verschwunden, auch wenn ich herzlich wenig von ihrer Lebensführung weiß und auch keinerlei Drang spüre, sie zu googeln, nur um erfahren zu müssen, dass es schon haufenweise Bücher gibt über (deutsche) Schnecken, ganz abgesehen von den indischen oder den schweizerischen Schnecken. Darum geht es mir ja auch nicht. Mir geht’s mehr um die stete Schulung des Auges, also der ständigen Wahrnehmung, wo wir diese ermüdenden und zähen Einstellungen kreiert haben im Hinblick auf die Welt und ihre Erscheinungsformen. Und gerade Tiere werden oft zum Verschwinden gezwungen, wenn sie jemandem im Weg stehen. Das heißt nicht, dass sie (die Schnecken) sich an dem Thymianstrauch vollfressen sollten, nein. Denn andere Menschen, die viel näher an der Problematik dran waren (und sind) als ich, haben kluge Dinge entworfen, die es den auf Sättigung ausgerichteten Geschöpfen erschwert, an unsere Salatköpfe zu kommen. Das sollte mich aber nicht davon abhalten, sie ab und zu mal namentlich zu begrüßen, denn wenn es meinen Liebesbereitschaftspegel erhöht, kann es nicht schaden.

Hekuba: Nie war ich im Innern der Schiffe:
Ich weiß von ihnen durch Gemälde, die ich
sah, und Worte, die ich hörte. *
Das ist auch so ein Thema, das in vielen Variationen durch die Weltgeschichte geistert: dass man sehr wohl Wissen anhäufen kann über das Innere der Schiffe (z.B.), indem man Gemälde studiert oder sich von Wissenskundigen belehren lässt, damit das Bild sich anreichert durch Interesse und Aufmerksamkeit. Aber egal, wieviel ich darüber nachgedacht habe, es fehlt dann doch die direkte, Erfahrung. Um zu wissen, wie es dort aussieht, muss ich in einem Schiffsbauch gewesen sein, und dann: in welchem. Jeder Schiffsbauch ein anderer, und doch geht es vielleicht hier nur um die Erfahrung, die durch Geruch und Gefühl und Geräusch ganz andere Dinge wahrnimmt als eine Buchseite das befördern kann, obwohl auch sie einiges Wunderbare vermag. Da ein ernster Umgang mit dem, was ich wissen will, empfehlenswert ist, drängt sich die Frage auf: um was geht’s. Geht es, um beim Beispiel zu bleiben, um die Navigationsgesetze, also Einstellungen, Richtlinien, Kompass, Steuerrad usw., und: wo geht die Fahrt überhaupt hin? In „Raumschiff Voyager“ durfte sogar mal eine Frau ans Steuerrad, ein Novum, obwohl man Gene Roddenberry nicht nachsagen kann, er hätte sich nicht um existentielle Durchbrüche in seiner anregenden Weltwahrnehmung bemüht. Auch kann man nicht so tun, als hätte sich nichts getan, obwohl ich die freie Handhabung eines Steuerrades bei Frauen zuweilen vermisse. Oft genug mussten sich Frauen in großen Gruppen zusammentun, um überhaupt einen Moment lang gehört zu werden, am besten zu genießen in dramatischen Chören, die der jeweiligen Tragödie eine Stimme geben. Die mächtige Klage „Ach und Weh!, was stricket ihr da, ihr unerbittlichen Gött:innen! ist auf die Erde zurückgeprallt, hinein in die Einzelheiten, also die menschlichen Lebewesen, die sich offensichtlich als gereift genug empfinden, um sich selbst (um beim Bild zu bleiben) als Nachen zu erfahren, der durch den Ozean steuert und auf einmal gewahr wird, dass es nie jemand anderen gab, der oder die am Steuerrad des Nachens saß (als man selbst). Oder aber sich langsam und sicher mit einem Stab vorwärts bewegend und sich im Innern des Körperschiffes neugierig umsehend: die Ausstattung, die Teppiche, die großherzige Räumlichkeit. Denn warum sollte es einem da wirklich schlecht gehen, wohnhaft im eigenen Schiff, mit jeder Pore atmend, damit das Lebendige den angemessenen Tribut erhält.
* Euripides: Die Troerinnen
Die Hölle der Lebenden ist nicht etwas, das
erst noch kommen wird. Wenn es eine gibt,
ist es die, die schon da ist. die Hölle, in der
wir jeden Tag leben, die wir durch unser
Zusammensein bilden. Es gib zwei Arten,
nicht unter ihr zu leiden. Die erste fällt vielen
leicht: die Hölle zu akzeptieren und so sehr
Teil von ihr zu werden, dass man sie nicht
mehr sieht. Die zweite ist riskant und verlangt
ständige Aufmerksamkeit und Lernbereitschaft:
zu suchen und erkennen zu lernen, was in der
Hölle nicht Hölle ist, und ihm Dauer und Raum
zu geben.
*Aus: „Die unsichtbaren Städte

Black/Gold III
Das Gold im Bild ist ein Ring, ein Schildkrötenring aus Indien. Als ich damals dann auch einen hatte, fiel mir auf, dass fast alle, die ich traf, einen am Finger hatten. Man sagte mir, der Kopf solle auf einen selbst gerichtet sein (warum, fragte ich), damit das Geld zu einem fließt. Das hat mich überrascht, denn es schien mir weit weg von der ursprünglichen Be/Deutung des Symbols. Die Schildkröte liegt praktisch vor den Füßen des Schöpfers (im einzigen Brahma-Tempel der Welt) und ist sein „Viman“, sein Flugobjekt. Er soll jedenfalls auf einer Schildkröte gelandet sein, sozusagen am Rande der Wüste Thar. Nie wird man wissen, und auch kein Roboter wird jemals wissen, wie viele halb-und missverstandene Sätze es gebraucht hat, bis aus einer frei im göttlichen Dienst stehenden Schildkröte eine Mammonspenderin werden konnte. Eine weitere Anekdote, die der Geist sofort aus den Archiven holen lässt, ist die Geschichte eines damals noch lebenden Wissenschaftlers, den eine indische Dame während des Vortrags über seine Weltdeutung unterbrach und ihn belehrte, die Schöpfung ruhe doch auf einer Riesenschildkröte. Der Gelehrte fragte sie, was denn d i e s e nun wiederum trüge, worauf sie ärgerlich antwortete, es seien Schildkröten bis unten. Nun habe ich mich so weit in das Schildkrötenthema hineingelehnt, dass ein schmaler Holzweg entstanden ist, und siehe da, eine Kreuzung. Zwei Schilder weisen in entgegengesetzte Richtungen. Das Schild links ist ein altes Brett, auf dem in schwer leserlicher Schrift steht: „Zu den Schildkröten“. Das rechte Schild scheint ganz neu montiert, nein, es ist sogar noch moderner: ein kleiner Robotty spricht direkt heraus aus der Schildbildfläche. Er sagt: „Zu den Schildkröten“. Verdammt nochmal, das ist nicht hilfreich. Zu welchen Schildkröten will man, und wer sagt, dass man überhaupt zu Schildkröten muss. Was ist da denn los, wo Schildkröten sind? Man weiß es nicht, es ist eine Bredouille. Man könnte rückwärts gehen, aber das scheint hier die am wenigsten attraktive Variante zu sein, also muss etwas entschieden werden. Die Schildkröte ist, wie ich erinnere, das älteste Symbol der Menschheitsgeschichte. Stark ist sie, und weise. Hartnäckig. Sie ist eine Lebenshüterin. Schon allein durch diese Eigenschaften kann man verstehen, dass, sollten wir als Spezies einmal nicht mehr da sein, die Schildkröte vermutlich immer noch da sein wird. Wie es denen allen dann gehen würde ohne uns, das würden wir auch nie wissen.

Beflügelt macht sich das Dunkle aus dem Staub
Es ist ja nicht so, als wäre man den Gefühlsanstürmen hilflos ausgeliefert, nein. Für was hat man das ganze Zeug gelernt und wollte wissen, wie es geht und wie andere es machen, um dann letztendlich zurückzukehren, von wo man ausging auf der verwegenen Wanderschaft. Schön, dass man Risiken nicht scheute und weit über die legalen Abgründe sich zuweilen dehnte, um dann zu wissen, wo Grenzen liegen, und wo es wirklich keine gibt. Allein die Tatsache ist erstaunlich, dass wir alles als so unverrückbar fest wahrnehmen können, während wir unentwegt unterwegs sind und fließend durch den Raum gleiten. Klar, da vergehen dann die Jahre und der Rückblick bietet sich an. Ob man zum Beispiel zum Verständnis des selbst entworfenen Spiels die Kenntnis der Quellen braucht, damit der Anker nicht zu lange festsitzt. Eben da, wo gar keine Heimat zu finden ist, oder wo Muster sich bilden wie kostbare Gewebe, und dann der Teppich zum Flug doch nicht tauglich. Auch kann einen die Macht des Nichtzuwissenden zu erdrücken drohen, bevor man das Lächeln wiederfindet, das einem gut steht: man akzeptiert die eigenen Grenzen, ohne den Weisheitsdurst zu verlieren. Wir sind ausgestattet mit allen möglichen Gaben und Fähigkeiten, da denkt man vielleicht, die Kraft wird bis zum Aschenrand reichen, und ich denke, sie tut’s. Sie kann bis zum Aschenrand reichen, auch dafür gibt es Bedingungen. Dem Geist kann man vieles zumuten, vor allem aber sich selbst. Bis zum allerletzten Atemzug leben wir unseren Film, dem kosmischen Vorführraum geschenkt und erhalten in Menschheitsgeschichte-Archiven.
 *
*
Yogini, durchs Ungewisse navigierend
Auf die Nachfrage, wie es einem geht, antwortet man meistens mit na gut, gut geht’s. Man will den Anderen ja nicht mit den eigenen Befindlichkeiten belasten, das erwarten die Gegegenüber auch nicht, sie wollen „gut“ hören, das ist entlastend und geht einen eh nichts an, denn alles davon Abweichende ist kompliziert. Kompliziert, weil jedes halbwegs authentische Interesse an der jeweiligen Befindlichkeit einem meist klar macht, dass man die Antwort darauf, würde jemand sich ernsthaft erkundigen, gar nicht weiß. Man weiß vielleicht gar nicht, wie es einem selbst geht. So war ich überrascht, dass ich heute früh an einem Tisch stand und mich auf einmal fragte, wie es mir eigentlich geht, oder wie ich mich fühle. Wäre ja schon interessant, herauszubekommen, wer wen hier fragt, wenn es eine Fragerin und eine Antworterin gibt. Sicherlich kann man jeh nach Einfallskraft die eine oder die andere Figur aus sich herauslotsen, die man dann jeweils befragen kann, aber sowas muss einem liegen. Als Antwort auf die schwierige Frage kam mir auf einmal die schwarze Yogifigur in den Sinn, die in einem unserer Räume steht. Ich fügte noch etwas Schwarz hinzu, schwärzer wollte ich es haben, tiefschwarz. Dann aber auch das Gold, das zu diesem Schwarz gehört: Es birgt eine Stille und dadurch eine eigene Schönheit. Natürlich lässt einen diese Art geistiger Leere auch an den Tod denken, wobei man sich selbst nur wünschen könnte, derart gelassen in andere Gefilde hinüberzuwandern, die noch nie ein Mensch zuvor gesehen hat, obwohl es auch da genügend anderweitige Behauptungen dafür gibt. Auch haben sich viele Menschen, allen voran die Künstler:innen aller Zeiten, ungeachtet aller Umstände bemüht, ihre gegebene Zeit mit dem, was sie waren, zu füllen. Und vielleicht war so mancher darbender 27-Jähriger näher an seinem Selbstsein als ein siebzigjähriger Bewohner des Schlaraffenlandes. Bei der Frage an mich, wie es mir geht, fand ich interessant, dass sie offensichtlich auf das Fühlen zielte, das zeigt sich als wirklich schwer. Oder nicht? Wenn ich zum Beispiel beim Schreiben, also der Wortkomposition, den Schwerpunkt im Denken vermute, so ist das Fühlen hier das unterstützende Element, ohne das der Fluss nicht in Gang kommt. Man kann konstruieren, ohne zu fühlen, aber man kann das dann auch sehen oder hören. Ich verstehe meine eigene Sehnsucht nach der Tiefenschwärze als einen Versuch, mich dem Tod gedanklich zu nähern, diesem ungeheuren Geschehen, das alles, was von der Welt erfahrbar war, verschlingt und nicht wieder hergibt, nein. Auch das persönliche Spiel lebt von dem Stoff, der durch mich möglich und sichtbar wurde, und wie ich mich selbst in meiner Rolle zurechtfand. Mit den Entscheidungen, an den Kreuzwegen, auf den Marktplätzen der Matrix. Als wer ich dann letztendlich gehe, hinein in die goldene Schwärze der Nacht.
* Yogi: Ursula Güdelhöfer
Photo: Kalima Vogt

lebendig
Und da draußen tobt das Menschsein unaufhaltsam vor sich hin, obwohl man gerne vermuten möchte, dass zwischendrin Oasen des (verhältnismäßigen) Friedens sich auftun und gestaltet und mit klugen Mitteln konstruiert werden. Denn egal, wie lange wir alle leben werden, so ist das verfügbar Beste (wie auch immer man es definiert) immer gut genug. Auch ein Putin weiß, dass der gewaltsame und schäbige Tod von 20 000 getöteten, russischen Soldaten allein in Bachmut nicht als Glanzleistung beurteilt werden kann. Ich frage mich, warum man so gar nichts von den Klageliedern der 20 000 russischen Müttern zu hören bekommt, die inzwischen doch wissen müssten, dass da was gar nicht gut läuft. Wir wiederum wissen nichts von der Gehirnwäsche, die dort gewählt wird, oder von der Todesangst, die Menschen in das große Schweigen zwingt. Auch bei uns sind Generationen in diesem Schweigen versunken, und sicherlich ist es der digitalen Revolution zu verdanken, dass nun das große Plappern möglich geworden ist. Und wenn man’s bedenkt, müsste dieser Redefluss bzw. diese Redefreiheit zu gesundem, menschlichem Verhalten führen, aber vielleicht muss es sich erst einmal austoben, bis es wieder zu sich findet, nur wo ist „sich“ bei all dem geblieben. Die sich von selbst gestaltende Beweisführung gegen die Fähigkeit des Menschen, sich fürsorglich um seinen Planeten als einzigen Wohnort zu kümmern, ist deshalb so gefährlich, weil alles Geschehende gerne von uns als das „Normale“ bezeichnet wird, wo es doch aller kühlen Beobachtung entsprechend eher der Irrsinn ist, der hier mächtig waltet, und d a s oft genug an der Spitze der Kulturen. Und man kann (z.B.) an den amerikanischen Verhältnissen entlang sehr gut sehen, dass es (wiederum) einem einzigen Menschen-(Mann) gelungen ist zu beweisen, das angeblich mächtigste Land der Erde so stark zu vergiften, dass man das Ganze nur noch als Groteske bezeichnen kann. Kommt aber endlich aus den ebenfalls existierenden, intelligenten Welten heraus ein Gegendruck, so sieht man ein zähes Ringen, nur von extrem starkem Willen überhaupt durchführbar, und der Ausgang ist immer noch offen, auch für uns als Völker, die wir voneinander abhängig sind. Niemand weiß, ob man überhaupt noch vom „Siegen“ reden kann, und die Frage „Worum geht’s eigentlich“ ist an jedem Tisch brauchbar. Als meine Katze noch lebte und ich viele Nächte mit Mäusen umgehen lernte, die sie mir als Geschenk (wie ich von Katzenkennern hörte) darreichte, konnte ich so manche Maus auch lebendig fangen und ließ sie bis zum Morgen in einem luftigen Behälter mit ein bisschen Nahrung. Manche von ihnen zogen sich sofort zurück und wirkten sterbebereit. Andere kämpften sich durch die Stunden hindurch in eine mögliche Freiheit, und waren ja dann auch frei, wenn ich sie ins Gras setzte. Was sagt mir das? Ich denk mal darüber nach.
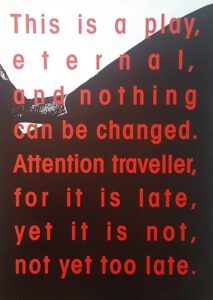 *
*


 *
*





 *
* *
*




 *
*