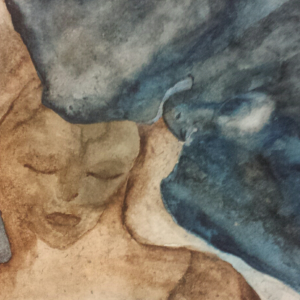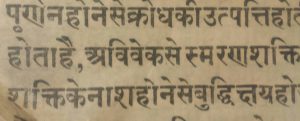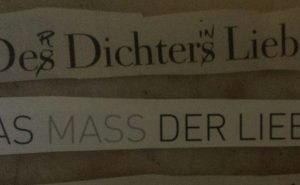In der letzten Zeit taucht bei mir immer wieder der Gedanke auf, dass es, wo und bei wem auch immer, eine erfrischte Wahrnehmung des Begriffes „Individuum“ braucht. Ich beziehe mich hier hauptsächlich auf die Bedeutung des Ungeteilten als etwas, was in letzter Konsequenz nicht nur ich selbst sein kann, und sich selbst verstehen, soweit möglich. Dazu gehört für mich die Anerkennung eines anderen Individuums als dieses Ungeteilte, das ich nie ganz werde ergründen können, von dem ich überhaupt nur verlässlich wissen kann, was er oder sie mir zu verstehen gibt, heißt, was der oder diejenige einerseits selbst von sich versteht, aber auch bereit ist, verständlich zu machen. Es ist ja durchaus das Schöne (und das Erschreckende) an menschlichen Begegnungen, dass wir selbst bei ähnlichen Voraussetzungen so einzigartig gestaltet sind. Entweder haben wir uns durch unser vermeintliches Schicksal weit über alle scheinbaren Notwendigkeiten hinaus gestalten lassen vom uns als unvermeidbar Definierten, oder wir haben die Gestaltungshoheit selbst übernommen, erkennend, dass niemand sonst dafür verantwortlich sein kann, auch nicht muss, und auch nicht soll. Zu gerne wird das Bündel abgegeben, und allmählich formt sich der mitgetragene Schatten zu einem Ungeheuer, für dessen Bewältigung man Hilfe braucht, und man kann dankbar sein, in einem Land zu leben, wo es ExpertInnen gibt für diese Kunst kompetenter Begleitung. Denn auch hier geht es nicht um „helfen“, und ja, es gibt sie, die vorübergehende Hilfeleistung, und ich danke allen Institutionen und Ehrenamtlichen für ihr Engagement, immer und immer mal wieder bedanke ich mich in Richtung Amnesty International, Greenpeace, Medica mondiale, usw., wo solche Leistungen auch ergreifende Frucht tragen können, danke. Das sind alles freie Entscheidungen auf der Basis von Fähigkeiten, die das Individuum durch sich selbst erkennt: was es mit sich beitragen kann zum Ganzen. Denn egal, wie man es selbst sieht, man trägt automatisch bei zur Weltlage, denn sie besteht aus uns, auch wenn die Ohnmacht über unsere Bedeutungslosigkeit uns gleichzeitig ergreifen kann. Je gründlicher und ernsthafter man bemüht ist, etwas zu erfassen, desto besser kann man auch für sich selbst entscheiden. Hat man eine längere Weile sorgfältig gesiebt, was einem gut tut und was nicht, was man förderlich findet für sich und andere, kann mal ja und mal nein sagen undsoweiter, kurz: hat das Meer der Dualitäten erfolgreich durchquert, auch manchmal ziemlich erschöpft, oder wütend, oder gelassen, kommt man bei unbeirrter Wanderung tatsächlich eines Tages an ein Tor. Kein Wächter in Sicht, keine Prüfungen, keine Aufgaben. Ist das nun der schrecklichste aller Schrecken, vor dem das Ich so zurückschreckt, oder kann ich „schreckte“ sagen!? Dabei hat es nichts gemein mit einer Finsternis, sondern alles ist nur da in seiner einfachsten Seinsweise. Man hielt das oft für sehr wenig, oder auch für zu viel. Mehr hat man nicht zur Verfügung. Man muss nur dranbleiben am Wohnhaften mit sich selbst. Denn von einem anderen Blick aus gesehen, kann eine alles überwiegende Tätigkeit die beste Ablenkung von sich selbst sein. Ja, jede/r soll tun, was er oder sie kann. Dann hören die Klagen auf, und jedermanns und jederfraus Ich kann an die Arbeit gehen, am besten immer vom Kern aus durch das Tor in die Welt.
Das Individuum: der Mensch als Einzelwesen in
seiner oder ihrer jeweiligen Besonderheit.
Bild: eine meiner Collagen aus früherer Zeit